Am 25. und 26. September 1922 fand in Weimar der Internationale Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten statt. Dort ging es heiter und kampflustig zu. Ein Beitrag von der Kunsthistorikern Gerda Wendermann.
Vor 100 Jahren lockte der Internationale Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten die Speerspitze der künstlerischen Avantgarde nach Weimar. Eingeladen vom Niederländer Theo van Doesburg und seiner Frau Nelly kamen am 25. und 26. September 1922 unter anderem Tristan Tzara, Kurt Schwitters, Hans Arp, El Lissitzky, László und Lucia Moholy-Nagy sowie der De Stijl-Architekt Cornelis van Eesteren zusammen. Van Doesburg, der umtriebige Mitbegründer der Zeitschrift De Stijl, war schon im April 1921 in der Hoffnung auf eine Anstellung am Staatlichen Bauhaus nach Weimar gekommen, wurde jedoch bald zum schärfsten Kritiker des dortigen Lehrbetriebs. Mit seinem De Stijl-Kursus, in dessen Folge sich in Weimar auch eine Stijl-Gruppe gründete, trug er bis 1923 nachhaltig zum inneren Wandel des Bauhauses vom Individualismus zum Funktionalismus bei.
Unter dem Pseudonym I. K. Bonset veröffentlichte van Doesburg ab Februar 1922 in Weimar die Dada-Zeitschrift Mécano, die die Strenge De Stijls mit dem Widersinn von Dada verband, wie es Kurt Schwitters forderte: „Der dadaistische Künstler weist der Zeit den Weg in die Zukunft. Er vereinigt in sich die Kontraste: Dada und Konstruktion. Nur konsequente Strenge ist das Mittel, um uns aus dem Chaos zu befreien. […] Dada ist der Übergang. Wollen wir an der Konstruktion einer neuen Zeit teilnehmen, sind wir verpflichtet, mit den einfachsten Mitteln anzufangen.“ An die Stelle des isoliert arbeitenden Künstlers und des damit verbundenen Geniekults setzten Dadaisten und Konstruktivisten das Ideal der Künstlergemeinschaft und die gemeinsame Suche nach einer elementaren, nicht-philosophischen und anti-individualistischen Kunst, die „ausschließlich aus ihren eigenen Elementen“ aufgebaut sein sollte.
„Der dadaistische Künstler weist der Zeit den Weg in die Zukunft.“
Theo van Doesburg, Februar 1922
Mitte Juli 1922 nahmen die Planungen für den Kongress Konturen an. Auch der in Paris lebende Rumäne Tzara, Dadaist der ersten Stunde, kündigte seine Teilnahme an. Van Doesburg schlug ihm daraufhin einen Vortrag über Dada mit Bezug zur Klassikerstadt vor: „Gegen Goethes Gebeine …“. Schwitters, der schon 1921 im Jenaer Kunstverein mit seinen Lautgedichten aufgetreten war, wollte in Weimar seine Collagen ausstellen. Schon im Vorfeld kam es jedoch zu Spannungen zwischen Dadaisten und Konstruktivisten. Moholy-Nagy schrieb, man wolle nach einem ersten gescheiterten Kongress in Düsseldorf „noch einmal die Möglichkeiten der Konstruktivistischen Internationale durchsprechen“. Van Doesburg war der Ansatz der Ungarn um Moholy-Nagy dagegen zu politisch: „Bei denen ging es darum, die Kunst dem Kommunismus unterzuordnen, bei uns, die Konsequenzen der neuen Kunst durchzusetzen“, konstatierte er noch im unmittelbaren Vorfeld des Kongresses am 18. September: Die „Internationale der Schöpferischen“ solle nur eine Arbeitsgemeinschaft sein, keine politische Vereinigung.
Wenig später kam es in Weimar zum offenen Konflikt zwischen van Doesburgs Dada-Freunden und den Konstruktivisten. Die Anwesenheit der Dadaisten löste dabei laut Moholy-Nagy „eine Rebellion gegen den Gastgeber Theo van Doesburg aus, da wir zu diesem Zeitpunkt den Dadaismus im Verhältnis zu der neuen Weltanschauung der Konstruktivisten als eine destruktive und überholte Bewegung bewerteten.“ So traf am 23. September nach Tzara und Arp auch Schwitters in Begleitung seiner Frau Helma ein. Nach einem Besuch des Bauhauses versammelte man sich im Atelier Karl Peter Roehls, wo Schwitters ein dadaistisches Gedicht mit Variationen über den Buchstaben W vortrug: „Eine Symphonie von Tönen, die uns für die nächsten fünf bis sechs Minuten den Atem verschlug und unseren eigenen Ohren nicht trauen ließ.“ (Hans Richter) Tags darauf fuhr die Gruppe nach Jena, wo sie von Walter Dexel, dem rührigen Leiter des Jenaer Kunstvereins, empfangen wurde und abends der feierlichen Eröffnung des neuen Stadttheaters beiwohnte – einem Projekt von Walter Gropius und Adolf Meyer, das als wichtiges Beispiel des neuen Bauens galt.
Als am Montag, dem 25. September, der eigentliche Kongress in Weimar begann, kam es zu heftigen Diskussionen über die Anwesenheit der Dadaisten, wie van Doesburg später ironisch berichtete: „Bortnyik hat in Ungarn den Dadaismus bekämpft – Lissitzky/Moskau sagt dem Dadaismus: Du hast von innen aufgeschnitten das Bauchgehirn der Bourgeoisie“, womit er auf eine Collage Hannah Höchs von 1919 anspielte. Höhepunkt war eine Dada-Soirée im Hotel Fürstenhof, dem heutigen Russischen Hof, für die van Doesburg eine Einladungskarte in typischer Dada-Typografie entworfen hatte. Einem Vortrag von Tzara, der statt über „Goethes Gebeine“ über die Dada-Bewegung in Paris sprach, folgte Hans Arp mit Gedichten aus seinem Band Die Wolkenpumpe, während Nelly alias Petró van Doesburg absurd klingende Stücke des jungen italienischen Komponisten Vittorio Rieti auf dem Klavier zum Besten gab. Der Abend endete schließlich feucht-fröhlich in der Kabarett-Bar Schwarzer Kater, einem Vergnügungslokal im Residenz-Theater im einstigen Weimarer Rotlichtmilieu am Brühl. Die Bar und auch der Zuschauerraum des Theaters galten mit ihren jüngsten Ausmalungen Karl Peter Röhls nach van Doesburg als erste wichtige De Stijl-Manifestation in Deutschland.
„Die Kunst, wie wir sie wollen, ist weder proletarisch noch bürgerlich, denn sie entwickelt Kräfte, die stark genug sind, die ganze Kultur zu beeinflussen“
Theo van Doesburg und Kurt Schwitters, März 1923
Über Dienstag, den 26. September, berichtete van Doesburg voll bissigem Spott in seiner Chronik des Kongresses, der Internationale Hahn habe nach vielem Drücken das erste konstruktivistische Ei gelegt: „Das dynamische Ei von Moholy ist zugleich ein Küken.“ Gemeint war wohl ein Text von Alfréd Kemény und Moholy-Nagy über das Dynamisch-konstruktive Kraftsystem, der 1922 in der Zeitschrift Der Sturm erschien. In Reaktion darauf veröffentlichen van Doesburg und Schwitters im März 1923 ein Manifest in Merz 2“ das von der dadaistischen Fraktion der Kongress-Teilnehmer unterschrieben wurde und sich gegen alle Bestrebungen richtete, die Kunst in den Dienst der Politik zu stellen: „Die Kunst, wie wir sie wollen, die Kunst ist weder proletarisch noch bürgerlich, denn sie entwickelt Kräfte, die stark genug sind, die ganze Kultur zu beeinflussen, statt durch soziale Verhältnisse sich beeinflussen zu lassen. […] Das, was wir hingegen vorbereiten, ist das Gesamtkunstwerk, welches erhaben ist über alle Plakate, ob sie für Sekt, Dada oder Kommunistische Diktatur gemacht sind.“
Am Mittwoch, dem 27. September, erklang mit Marcia nuziale per un coccodrillo (Hochzeitsmarsch für ein Krokodil) nochmals eine jener ungewöhnlichen Kompositionen Rietis vor dem damaligen Landesmuseum, dem heutigen Museum Neues Weimar, bevor es für eine Dada-Soirée („DadaRevon“) wieder nach Jena ging. Dort schien indes die Spannung zwischen den Fraktionen am Siedepunkt angekommen: „Im Kunstverein war der Saal mit einer äusserst misstrauisch und feindlich blickenden Zuschauerschar gefüllt, als Doesburg mit schwarzem Hemd und weißer Krawatte, bleich, aber gefasst, zum Rednerpult schritt. Schwitters sah eine kleine Katastrophe voraus und kam seinem Freund vorbeugend zu Hilfe. Er trat unversehens vor und erklärte mit eindringlicher Stimme: ‚Jena ist die einzige Stadt in Europa, in der es vorgekommen ist, dass jemand es wagte, bei einem Vortrage van Doesburgs zu pfeifen. Dass dergleichen nicht wieder passiert! Bleiben Sie gefälligst ganz still und hören Sie schön zu!‘ […] Und so unglaublich das ist: der Bann hielt wirklich über den Vortrag Doesburgs an, der ohne Zweifel gut war, aber extrem und aggressiv, wie es in Doesburgs Art lag, wenn er sich Gegnern gegenübersah. Und dann schritt Nelly zum Flügel und ließ den ‚Elefantenmarsch’ los. Da gab es dann bald kein Halten mehr. Man zischte und pfiff, während Nelly unbeirrt weiterspielte […]. Bei Schwitters’ Gedichten herrschte dann wieder einige Ruhe, da der alte Magier die Leute in Bann schlug. Dafür brach bei Hans Arps Vorlesung plötzlich ein Höllenlärm los. Das Publikum fühlte sich verspottet […] und begab sich, erregt diskutierend, nach Hause.“ (Werner Graeff)
Trotz vieler Differenzen blieb der Ton zwischen Dadaisten und Konstruktivisten aber freundschaftlich, denn im Anschluss reisten neben Schwitters, Arp, Tzara und den Doesburgs auch das Ehepaar Dexel, Burchartz, Lissitzky, Röhl sowie László und Lucia Moholy-Nagy weiter nach Hannover, wo am 30. September in der Galerie Garvens ein zweiter „DadaRevon“-Abend stattfand. Hier feierten sie ein letztes absurdes Spektakel, bevor sie sich wieder in alle Himmelsrichtungen verteilten. Das Blatt der Geschichte wendete sich freilich bald zugunsten der Konstruktivisten. Während László Moholy-Nagy im April 1923 als Ingenieur-Künstler an das Bauhaus berufen wurde, wo er eine dynamisch-konstruktive Kunst unter Einsatz neuer Medien propagierte, zog sich Theo van Doesburg bereits Anfang 1923 desillusioniert aus Deutschland zurück. Seine Idee der Gründung einer unabhängigen „Konstruktivistischen Internationale“ blieb Utopie. Trotzdem resümierte er Ende 1922 versöhnlich: „So wurde Weimar einerseits der Kampfplatz gegen den Expressionismus, andererseits der fruchtbare Boden für eine neue Gestaltung in Deutschland.“


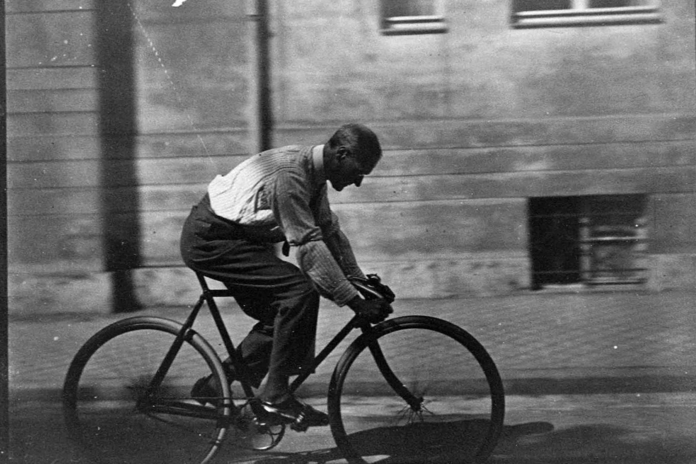


Neuen Kommentar schreiben