‘Was gelernt?
von /Wie jede Ausstellung ist Olaf Metzels Deutschstunde Teil eines komplexen Beziehungsgeflechts – und regt so dazu an, sich mit den Verbindungen und Spannungen, die darin wirken, auseinanderzusetzen.
Jede Ausstellung ist ein Verbindungssystem diverser Akteur*innen und Entitäten. „Jede kuratorische Situation bedeutet ein Zusammenkommen im Interesse des Öffentlich-Werdens von Kunst und Kultur. Auf diesem Wege entsteht dort ein Beziehungsgeflecht sämtlicher menschlicher und nicht-menschlicher Mitwirkender untereinander – der Exponate, Künstler*innen und Kurator*innen, aber auch aller übrigen Beteiligten, den Kritiker*innen, den Gestalter*innen, den Architekt*innen etwa […], ebenso aber auch den Displaygegenständen, Vermittlungsmedien und Architekturen, den Räumen, Orten, Informationen und Diskursen. Sie alle treten miteinander in neue Verbindung,“[1] fasst Beatrice von Bismarck treffend zusammen. Besonders wirkmächtig und prominent in dieser Situation sind in ihrer notwendigen, manchmal langanhaltenden oder permanenten physischen Präsenz dabei sowohl das ausgestellte Objekt als auch der Raum und der Ort, an dem diese zur Schau gestellt werden. In einer Ausstellungssituation, sei es eine temporäre Sonderausstellung, eine dauerhafte Sammlungspräsentation oder die kuratierten Räume historischer Gebäude, sind Raum und Exponat untrennbar miteinander verbunden und werden zwangsläufig – als Teil des kuratorischen Konzepts oder nicht – zusammengelesen. Dies mag auf den ersten Blick eine simple Erkenntnis sein, die aber in der Praxis weitreichende Folgen haben kann.
Denn dass Orte, ja ganze Landstriche, oft keine neutralen Standorte und unbesetzten Behältnisse für Kunstwerke oder Kulturgüter darstellen, ist lange bekannt.[2] Schon Friedrich Nietzsche wusste, dass sich auch Gebäude und deren Gestaltung zu mehr eignen, als mit Stein und Mörtel vor den Elementen zu schützen: „Im Bauwerk soll sich der Stolz, der Sieg über die Schwere, der Wille zur Macht versichtbaren; Architektur ist eine Art Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, selbst schmeichelnd, bald bloss befehlend.“[3] Tatsächlich begegnen wir in Ausstellungsräumen deren – vielleicht wechselvoller – Geschichte, unterschiedlichen Nutzungszwecken und eigener Ikonographie.
Vice versa verdeutlicht Walter Benjamin, dass auch Kunstwerke über eine ganz individuelle und höchstpotente Aufladung verfügen können. Deren einzigartige „Aura“ entsteht nach Benjamin hauptsächlich durch die „ursprüngliche Art der Einbettung des Kunstwerks in den Traditionszusammenhang [die] ihren Ausdruck im Kult [fand].“[4] Spätestens seit den modernen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts wird Kunst nicht mehr für kultische, religiöse oder magische Raumzusammenhänge hergestellt. So kann man die „Aura“ eines Exponats im Kontext der vorliegenden Überlegungen sicher auch als die idiosynkratische Präsenz des Objektes verstehen, als das was an einem Kunstwerk formell einzigartig und spezifisch ist, die in einem Kunstwerk angelegte oder mit ihm verknüpfte Nutzung, (Provenienz-)Geschichte, Botschaften, Inhalte, Narrative und Konnotationen.
Was passiert nun, wenn diese möglicherweise individuell bereits stark besetzten Entitäten im Rahmen einer Ausstellung zusammentreffen? Raum und Ort sowie Exponat, Objekt und Kunstwerk befinden sich dann im Dialog, wenn nicht in einem Streitgespräch, sie kollidieren miteinander, sie reiben sich aneinander, können ihre mitunter immense Kraft gegenseitig unterhöhlen und unterwandern oder potenzieren. Ein wichtiger Aspekt des Ausstellungsmachens besteht darin, diese Fliehkräfte zu erkennen, zu steuern, oder gar für sich fruchtbar zu machen.
Ein Künstler, der sich dieser Dynamiken wohlbewusst ist, ist derzeit im Weimarer Schloss Belvedere zu sehen. Olaf Metzel (*1952) hat seine Ausstellung Deutschstunde mit 8 existierenden und zwei für diese Ausstellung angefertigten Kunstwerken in der zwischen 1724 und 1748 erbauten barocken Sommerresidenz der Familie von Sachsen-Weimar und Eisenach aufgebaut.[5] Das Schloss liegt inmitten einer ausgedehnten Park- und Gartenanlage auf einer Anhöhe südlich von Weimar. Die Sichtachse ist auf das im Tal liegende Zentrum der Klassikerstadt ausgerichtet, aber auch der Glockenturm des 1958 erbauten Mahnmals für das Konzentrationslager Buchenwald, das zwischen 1937 und 1945 auf dem gegenüber liegenden Ettersberg von den Nationalsozialisten betrieben wurde, ist gut zu erkennen. Auf einen Blick sind so zwei der Faktoren zu erfassen, die noch heute die Wahrnehmung der Stadt prägen: Zum einen steht Weimar beständig für die „Weimarer Klassik“ Friedrich Schillers und Johann Wolfgang von Goethes, die deutsche humanistische Hochkultur um 1800, deren Protagonisten hofften, mit (ästhetischer) Bildung und Kultur die europäische Gesellschaftsordnung zu erneuern. Zum anderen steht die Stadt für die Weimarer Republik und deren Scheitern sowie den drastischen Konsequenzen dieses Umbruchs, die im 2. Weltkrieg und den ungeheuerlichen Gräueltaten der Nationalsozialisten mündeten.
Für gewöhnlich ist in den Schlosssälen Kunsthandwerk, vor allem eine Porzellankollektion mit einem Schwerpunkt auf Objekten aus thüringischer Herstellung, zu sehen. Deren Präsentation wird momentan neu konzipiert und die Exponate wurden museal ausgelagert, was Metzel die Gelegenheit gibt, uns eine Deutschstunde zu erteilen. Er konfrontiert das Weimarer Publikum dabei mit kontroversen, zeitaktuellen Themen und was uns erwartet, sei durch ein Zitat Metzels von 2022 angedeutet: „Wenn man sich auf ein neues Projekt einlässt, ist es immer eine Reise ins Ungewisse. […] Der Freiraum, den man sich durch die Realisierung erarbeitet, ist der entscheidende Moment bei der Arbeit, weil man eben nicht weiß, wohin er führt und wo der Weg endet. Die Kunst ist dazu da, exzessiv eine gesellschaftliche Haltung zu reflektieren. Dazu gehört auch nihilistische Respektlosigkeit. Abgesehen davon sind Regeln dazu da, um gebrochen zu werden.“[6]
Zunächst fällt jedoch auf, wie geschickt die Werke zu den ihnen zugeordneten Räumen Bezug nehmen. Sicher ist es kein Zufall, dass die großformatige Installation, die dem Publikum nach dem Erklimmen der repräsentativen Schlosstreppe auf der ersten Etage begegnet, Millieufragen von 2007 ist. Die 24 aneinandergereihten Pissoirs aus weißem Beton, von Metzel manipuliert und bemalt, referenzieren zum einen die revolutionären Ready-Mades von Marcel Duchamp, können andererseits aber gleichermaßen als ironische Anspielung an die üblicherweise im Schloss angesiedelte Porzellansammlung gelesen werden.
Demokratisierend ersetzt Metzel Statussymbole der regierenden Elite – der Erbauer des Schlosses, Herzog Ernst August, legte in den 1730er Jahren die Grundsteine für die Porzellansammlung – mit einem Alltagsgegenstand, der für körperliche Bedürfnisse gedacht ist, die allen Gesellschaftsschichten, allen Milieus, gemein sind. Der Künstler praktiziert bewusst die radikale Aneignung und Umnutzung des Raums und führt eine gesellschaftspolitische Ebene ein. Der Ton für die weitere Ausstellung ist somit gleich zu Beginn gesetzt.
Farbigkeit und Oberflächenstruktur von Metzels Arbeiten harmonieren oder stellen sich in einen reizvollen Kontrast mit der prunkvollen Innenausstattung. Die grauen Rechtecke der Betonskulptur Berliner Kindheit, 2020, im Eingangsbereich des Schlosses, spiegeln sich in den quadratischen grauen Bodenfliesen ebenso wie im gräulichen Stuckmarmor, mit dem die Säulen hinterfangen sind. Die bunten Seiten der für Deutschstunde, 2024, in Metall verewigten Zeitungen passen besonders gut zum vielfarbigen Stuckmarmor des Westpavillions. Den Sockel aus schwarzem Marmor der neu für die Ausstellung in Weimar angefertigten Skulptur Oberkante Unterlippe, 2024, hat Metzel bewusst gewählt, „weil die Marmorwände da so dominieren“.[7] Die Skulptur Roter Beton, 1981, hebt sich besonders gut von der gelben Textiltapete ihres zugewiesenen Zimmers ab und die Holzpalette, auf der das Werk platziert wurde, mag mit einem Augenzwinkern auf den transitorischen Status dieser Ausstellung und der Raumausstattung generell verweisen, auf den auch die nun verwaisten Glasvitrinen, die in einigen der Räume verblieben sind, manifestieren. Raum und Objekt sind für die Dauer einer Ausstellung eng verbunden, oft aber eben nur temporär. Danach können die Exponate an neuen Orten wieder neue Verbindungen eingehen, die neue Botschaften senden.
Doch dieser Gleichklang bleibt oberflächlich. Metzels Installationen und Skulpturen können ihren Status als fremdartige Störfaktoren kaum verbergen: Allein die für das 20. und 21. Jahrhundert ikonischen Materialien Stahl und Beton sowie deren teils grobe Bearbeitung konterkarieren das feine, erhabene, durchkomponierte barocke Dekor und ziehen uns gnadenlos in unsere Gegenwart. Zudem bestimmen sie aufgrund ihrer teils beachtlichen Größe den Raum und die Wegeführung. Die Installation ich hasse schule, 2010, bestehend aus von Gymnasiast*innen bekritzelten Schultischen und -stühlen, stellt sich den Besuchenden gleichsam in den Weg und blockiert die Gänge zwischen den Sälen. Man ist direkt mit den Bestandteilen der Installation konfrontiert und gezwungen, sich mit ihnen fast körperlich auseinanderzusetzen.

So wie die Werke materiell und physisch dem Raum entgegenstehen, so bringt Metzel Themen nach Weimar und in das Schloss, die hier fremd sind. Oder eben doch nicht? Exemplarisch seien Kebap Monument, 2007, und Turkish Delight, 2006, genannt, in denen Metzel sich nuanciert mit Immigration und Integration auseinandersetzt. Er verweist hier als Hintergrund auf seine eigene Kindheit in den Berliner Bezirken Neukölln und Kreuzberg, die seit den 1960er und noch heute sichtbar von vor allem türkischer Einwanderung geprägt sind.[8]
Besonders Turkish Delight muss in seiner Widersprüchlichkeit eine Reaktion hervorrufen: Die Bronzestatue einer jungen Frau ist bis auf ein Kopftuch unbekleidet. Spätestens jetzt ist es aus mit dem erbaulichen Lustwandeln im Schloss mit der schönen Aussicht, denn Metzel fordert die Auseinandersetzung mit seinen Themen. Er sagt über Turkish Delight: „Es stellt sich die Frage, wo enden Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst. Natürlich respektiere ich andere weltanschauliche Meinungen und bin auch jeder Zeit zur Diskussion bereit. Aber auf der Basis des sachlichen Dialogs. Auf ihre ruhige Art ist die Aussage der Figur sehr präzise. Sie spricht das Thema der Integration und der Identität gleichermaßen an. Es geht nicht um Provokation, sondern um Dialog und Diskussion. Wie schaut es aus im Westen, mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, wo der Körper der Frau einer exzessiven Vermarktung unterliegt? Und wie schaut es aus im Osten, wo Frauen zum Teil aus dem öffentlichen Leben verbannt sind und über ihren Körper nicht alleine verfügen können? Das sind wichtige Schnittstellen zwischen den Kulturen.“[9]
Wie Ausstellungsraum und -ort mit seinen Werken zusammenspielen, ist ein Kerninteresse Metzels. Seine Arbeiten finden sich oftmals im öffentlich Raum und sind somit unmittelbar mit dem Publikum und der Umwelt verbunden. Die Skulptur 13.4.1981 (Randale-Denkmal), 1987, das an Ausschreitungen und Plünderungen der linken Szene ebenso wie an die darauffolgende Polizeigewalt in Berlin erinnert, wurde ob ihrer kontroversen Natur mehrfach in Berlin umplatziert. Die in Beton gegossenen Eierkartons, die er 1987 anlässlich der documenta 8 im Treppenhaus des Fridericianums installierte, sollten die nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg mit diesem Material wieder aufgebaute Kasseler Einkaufszone in das Museum bringen und laut Metzel somit „den Außenraum ins Museum […] transportieren“.[10]Roter Beton stand zuerst in einer besetzen Ladenwohnung in Berlin.[11] Im Zusammenhang mit der Weimarer Ausstellung betont der Künstler: „ich bin ja Bildhauer […], ich beschäftigte mich nun mal mit Raum und dementsprechend die Arbeiten dort [im Schloss Belvedere] einzubringen und pointiert zu präsentieren – das war mir wichtig […].“[12]
Es kann also zurecht angenommen werden, dass es durchaus beabsichtigt ist, dass einige der Werke gerade im Weimarer Ortskontext besondere Signifikanz entwickeln und der Künstler auf die ein oder andere intellektuelle Transferleistung hofft. Berliner Kindheit etwa, bezieht sich nicht nur auf die Kindheit des Künstlers selbst, sondern auch auf Walter Benjamins 1950 posthum erschienenen Erinnerungen Berliner Kindheit um die Jahrhundertwende, in denen Metzel immer wieder Parallelen zu seiner eigenen Erfahrung erkennt.[13]Deutschstunde ist nicht nur der Titel der Ausstellung, sondern auch der eines 1968 publizierten Romans von Siegfried Lenz. In dem Buch, dessen Rahmenhandlung in einer Erziehungsanstalt angesiedelt ist, geht es unter anderem um individuelle Schuld und Verantwortung unter der nationalsozialistischen Diktatur. Zudem sei ein Hinweis auf Goethes West-östlicher Divan von 1819 erlaubt, der immerhin die bekannten und hier nicht ganz irrelevanten Verse enthält
„Wer sich selbst und andre kennt,
Wird auch hier erkennen:
Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen.
Sinnig zwischen beiden Welten
Sich zu wiegen, laß ich gelten;
Also zwischen Ost und Westen
Sich zu bewegen, sei’s zum Besten!“[14]
Womit haben wir es also in der Summe zu tun? Metzel meint, der Künstler müsse im Zusammenspiel von Kunst und Gesellschaft ab und an „die Notbremse ziehen“[15] und wem nun was im Thüringer Wahljahr 2024 bis Oberkante Unterlippe steht, sei dahingestellt. Die Ausstellung Deutschstunde ist eine Parabel über global und lokal brandaktuelle Themen und die Notwendigkeit, diese immer wieder aufs Neue differenziert zu betrachten und zu diskutieren. Dafür bietet der Künstler mit seinen Werken einen Anlass und konkrete Ausgangspunkte, lädt zum Dialog und der kritischen Auseinandersetzung ein. Überdeutlich macht er dabei – vielleicht in Anlehnung an die Visionen Goethes und Schillers, dass das Fundament aller Gespräche sein muss, sich über die jeweiligen Themen zu informieren, sich selbst und unsere Jugend zu bilden. Auch wenn Metzel zugibt, selbst nicht gerne zur Schule gegangen zu sein, „die Bildung – egal wo, egal wie – ist das A und O.“[16] Dazu gehört auch die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte. Denn Metzel weist auf Orientierungspunkte in der deutschen Kultur und der Historie Deutschlands hin, die vom Standort Weimar potenziert werden. Die Stadt weiß mahnend davon zu berichten, dass Demokratie als politisches System scheitern kann und in welch dunkle Abgründe dies zusammen mit Ausgrenzung, Fremdenhass und Intoleranz führen kann. Die Ausstellung bietet aber auch Auswege an, indem sie auf die Entscheidungsfreiheit des Individuums als einen entscheidenden Faktor hindeutet, aber auch auf die Kraft von Informationen und Fakten. Und, ´was gelernt?





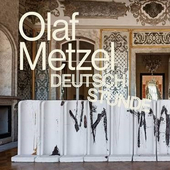

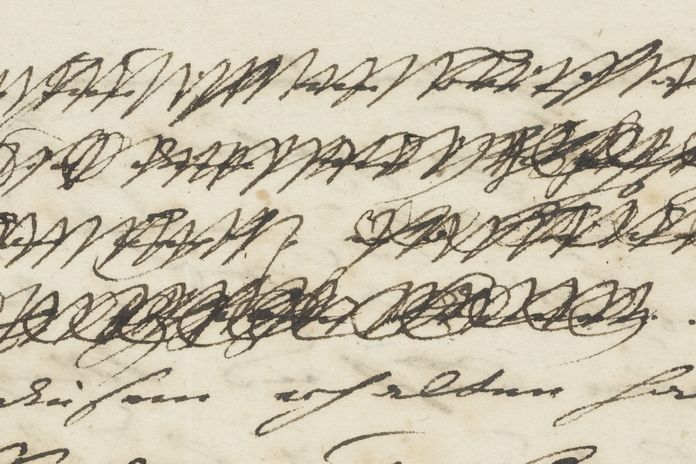


Neuen Kommentar schreiben