Die erste bekannte Abbildung einer Tulpe in der Geschichte findet sich im Codex Kentmanus in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Die Zeichnungen der Handschrift aus dem 16. Jahrhundert sind botanisch und kulturhistorisch wertvolle Zeugnisse der Zeit.
Die Tulpe, die lange als die begehrteste Blume der Welt galt und außergewöhnliche Leidenschaften weckte, wurde nach heutigem Kenntnisstand erstmals in der Geschichte in einem Manuskript der Herzogin Anna Amalia Bibliothek abgebildet. Es handelt sich um zwei aquarellierte Federzeichnungen im bekannten Codex Kentmanus, benannt nach seinen Verfassern, den beiden sächsischen Ärzten Johannes (1518–1574) und Theophilus Kentmann, respektive Vater und Sohn. Johannes hatte sie zwischen 1547 und 1549 in Italien gesehen und gezeichnet und nahm sie in seine Sammlung von Pflanzenbildern auf, die einen Großteil des Codex Kentmanus ausmacht. Einmal zeichnete er sie vermutlich als Trockenpflanze ab, weil sie nur mit fünf Blütenblättern gezeigt ist, während die Tulpe sechs davon hat. Das zweite Mal zeichnete er sie nach einem Frischexemplar ab, erkannte sie aber nicht als solche, sondern hielt sie für eine Narzissenart.
Die Zeichnungen gelten heute als die ältesten bekannten Darstellungen dieser Pflanze und sind damit eine herausragende Einzelleistung Kentmanns. Die dargestellten Blumen werden beide als „Wilde Tulpe“, Tulipa sylvestris, identifiziert. Heute geht die Forschung davon aus, dass die Pflanze ursprünglich in Nordafrika und Südeuropa beheimatet war. Zu Kentmanns Zeit war ihr Aussehen nördlich der Alpen nicht bekannt. Zweifellos brachte Kentmann von seiner Italienreise auch Tulpenzwiebeln mit in seine Heimatstadt Dresden, auch wenn die Zucht der Blume in seinem Garten nicht belegt ist.
Die türkische Tulpe – Eine Sensation unter Botanikern
Kentmanns Bild war eine Sensation unter den Botanikern im deutschsprachigen Raum und hatte eine enorme Wirkung, weil Bilder seltener Pflanzen Mitte des 16. Jahrhunderts immer noch eine Ausnahme waren oder, wie im Falle der Tulpe, tatsächlich noch nicht existierten. Kentmann bezeichnete eine Darstellung als „Tulipa Turci“, Tulpe der Türken, weil er glaubte die Blume sei aus der Türkei importiert worden, wie es mit anderen Tulpenarten später wirklich vermehrt geschehen sollte. Die Einfuhr der Tulpe aus dem Osten führte in den folgenden Jahrzehnten in Europa zu einer „Tulipomanie“, in deren Verlauf viele Unglückliche ihr gesamtes Hab und Gut für Sammlungen von Zuchttulpen ausgeben und verlieren sollten.
Kentmann lieferte auch eine Erklärung für den Namen der Blume. Er notierte in einem Kommentar, die Blume habe ihren Namen von dem türkischen Wort „Tulipa“ erhalten, das sich laut den Berichten türkischer Reisender auf die Form der „dalmatischen Kappe“, das heißt vermutlich des Turbans, bezog:
„Die Türken nennen diese Pflanze in ihrer Volkssprache ‚Tulipa‘; was das ist, weiß ich nicht. Einige Türken behaupten, der Name käme daher, dass die Blume dem dalmatischen ‚Pileolus‘ ähnelt.“ (Fol. 124r)
Die früheste Tulpendarstellung?
Manchmal wird die früheste Tulpendarstellung irrtümlich den Medizinern und Gelehrten Conrad Gessner (1516–1565) und Leonhart Fuchs (1501–1566) zugesprochen. Von dem in Tübingen ansässigen Fuchs, der zu den sogenannten „Vätern der Botanik“ gezählt wird und 1542 das einflussreiche Kräuterbuch Historia stirpium gedruckte hatte, sind sechs Tulpenbilder überliefert. Fünf davon sind später als Kentmanns angefertigt worden und die sechste Darstellung hat die Forschung mittlerweile als Kopie von Kentmanns Tulpendarstellung identfiziert. Auch der Züricher Conrad Gessner ließ nachweislich Kentmanns Tulpe abpausen.
Schließlich kopierte der Nürnberger Apotheker Georg Öllinger Kentmanns Tulpe zwischen 1550 und 1553 für ein Florilegium, das heißt eine Sammlung ästhetisch anspruchsvoller Pflanzenzeichnungen, das er selbst anfertigte. Es steht zu vermuten, dass Kentmanns Tulpenzeichnung auch auf andere Gelehrte gewirkt hat. Der Codex Kentmanus enthält noch weitaus mehr außergewöhnliche Zeichnungen, doch gelten die Tulpen aus botanischer und kulturhistorischer Perspektive bislang als die bemerkenswertesten Darstellungen.

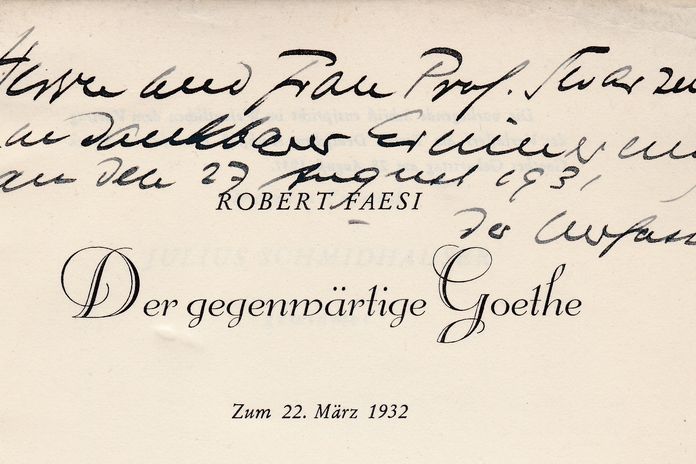
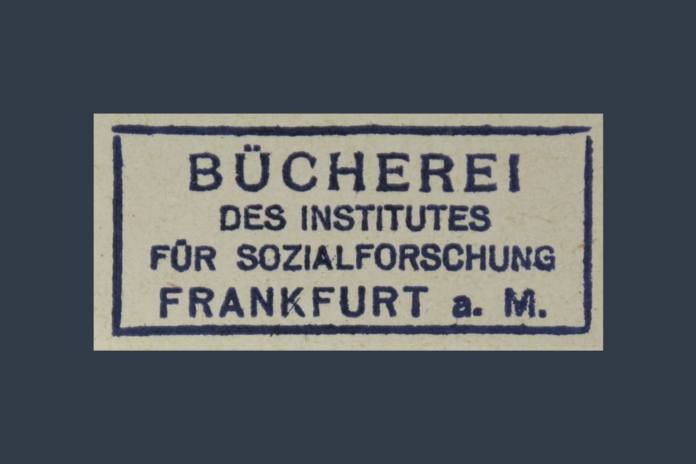


Neuen Kommentar schreiben